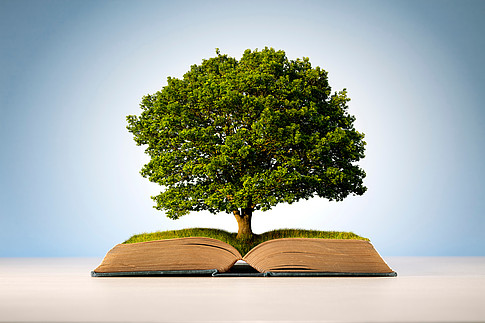Was ist Biodiversität?
Biodiversität ist überall. Sie ist in jeder Blume, jedem Tier und in jedem noch so kleinen Bakterium. Überall, wo Leben ist, ist auch Biodiversität. Doch was für viele nur ein sperriger Fachbegriff ist, ist in Wahrheit das Fundament allen Lebens auf unserem Planeten. Und dieses Fundament fängt an zu bröckeln.
Sie umfasst nicht nur Millionen verschiedener Tier- und Pflanzenarten, sondern auch Mikroorganismen, Gene und Lebensräume sowie die komplexen Wechselwirkungen, die diese Elemente miteinander verbinden. Biodiversität beschreibt die unglaubliche Vielfalt des Lebens und die Art und Weise, wie alle Lebewesen miteinander verknüpft sind. Ohne diese Vielfalt wäre das ökologische Gleichgewicht gestört, was dramatische Folgen für uns Menschen und unsere Umwelt hätte.
Dieses Netzwerk aus Vielfalt sorgt dafür, dass Ökosysteme stabil bleiben, saubere Luft und Wasser verfügbar sind und fruchtbare Böden entstehen. Es liefert uns Nahrung, Medizin und reguliert unser Klima. Biodiversität ist das Netz des Lebens und der Mensch hängt mitten darin.



Biodiversität in der heutigen Zeit
Das sechste Massenaussterben
Nach heutigem Stand der Forschung hat unser Planet in seiner Geschichte mindestens fünf große Massenaussterben erlebt. Dabei handelt es sich um Ereignisse, bei denen innerhalb relativ kurzer Zeiträume ein Großteil aller Arten verschwand. Das bekannteste dieser Ereignisse ist das Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren, das wahrscheinlich von einem Asteroideneinschlag verursacht wurde. Diese Umweltkatastrophe führte zum Aussterben von 75 % aller Tier- und Pflanzenarten. Welches Ausmaß dieses Ereignis damals wirklich hatte, ist für uns heute nur schwer vorstellbar. Was jedoch vielen nicht bewusst ist, ist, dass sich das sechste große Massensterben direkt vor unseren Augen abspielt und das jeden Tag.
Im Mai 2019 veröffentlichte der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) seinen globalen Bericht über den Zustand der biologischen Vielfalt (IPBES, 2019). Daraus geht hervor, dass bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten in den kommenden Jahrzehnten verschwinden könnten. Die aktuelle Aussterberate liegt bereits heute um ein Vielfaches über dem natürlichen Durchschnitt der letzten zehn Millionen Jahre. Ein entscheidender Unterschied zu früheren Massenaussterben in der Erdgeschichte ist die Ursache. Während diese bislang durch Naturereignisse ausgelöst wurden, geht das gegenwärtige Artensterben maßgeblich auf menschliche Einflüsse zurück. Zu den Hauptursachen zählen vor allem die Zerstörung und Fragmentierung von Lebensräumen, etwa durch Abholzung, Flächenversiegelung oder Umwandlung von Ökosystemen in landwirtschaftlich genutzte Flächen. Auch der Klimawandel und weitreichende Umweltbelastungen durch Pestizide, Stickstoff und Plastikverschmutzung, gefährden zahlreiche Arten direkt oder indirekt. Auch die Übernutzung natürlicher Ressourcen, wie auch die Einschleppung invasiver Arten, also Arten die in neue Regionen gelangen und dort die heimischen Arten verdrängen, sind eine massive Bedrohung für Ökosysteme (IPCC, 2022). Diese Entwicklungen betreffen nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt, sondern haben auch langfristige Auswirkungen auf den Menschen.
Biodiversität in der Zukunft
Die gute Nachricht ist: Es ist noch nicht zu spät, und jeder Schritt zählt. Die Natur hat ein beeindruckendes Potenzial zur Regeneration, wenn wir ihr dabei helfen. Wissenschaft und Praxis zeigen es deutlich: Mit Wissen, Verantwortung und Engagement können wir gemeinsam eine lebenswerte, artenreiche Zukunft gestalten. Hierbei braucht es nicht nur große Projekte oder Institutionen, sondern es beginnt bei uns selbst. Schon kleine Veränderungen im Alltag, auf dem Balkon, im Hinterhof oder in unserer Denkweise können einen spürbaren Unterschied machen. Jede*r kann mitmachen, und genau darin liegt die Stärke.
Wer heute beginnt, gestaltet morgen mit für eine Welt, in der Vielfalt wieder Platz hat. Hier sind einige Beispiele dafür, wie Biodiversität aktiv gefördert werden kann.
Lassen Sie beim Mähen im Garten ein paar Quadratmeter Wiese ungemäht. So können Wildblumen blühen und wertvolle Nahrung für Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber bieten.
Belassen Sie Totholz, wo es möglich ist. Ein alter Asthaufen oder ein abgestorbener Stamm können wertvoller Lebensraum für Insekten, Pilze und kleine Säugetiere sein.
Mini-Insektenhotels können aus einfachen Materialien wie Bambusröhrchen, Ton und unbehandeltem Holz selbst gebastelt werden. Sie passen auf jeden Balkon und in jeden Garten.
Wasserstellen für Insekten und Vögel: Ein flacher Teller mit Wasser und Steinen bietet Bienen, Schmetterlingen und Vögeln an heißen Tagen eine dringend benötigte Trinkquelle.
Heimische Wildblumen oder Kräuter wie Thymian, Salbei oder Wilde Möhre ziehen Bestäuber an, auch in Töpfen oder Balkonkästen.
Verzichten Sie auf chemische Pflanzenschutzmittel und greifen Sie lieber zu natürlichen Alternativen.
Sammeln Sie Samen von heimischen Wildpflanzen, ziehen Sie Jungpflanzen heran und teilen Sie sie mit Nachbar*innen. So entsteht ein Netzwerk artenreicher Flächen.
Informieren, inspirieren, mitreden: Sich über Biodiversität zu informieren, ist ein wirkungsvoller erster Schritt. Denn wer versteht, wie faszinierend und schützenswert unsere natürliche Vielfalt ist, kann dieses Wissen mit anderen teilen, zum Umdenken anregen und mit kleinen Taten Großes bewirken. Jedes Engagement zählt und macht Mut, gemeinsam etwas zu verändern.
Die Universität Graz zeigt mit ihren aktuellen Projekten, wie konkrete Maßnahmen im urbanen Raum umgesetzt werden können. Ob Blühwiesen, Totholzstrukturen, Nistkästen oder Sandarien: Diese Vorhaben können als Inspiration für eigene Schritte dienen, im Kleinen wie im Großen.
Denn es geht um weit mehr als das Überleben einzelner Arten. Es geht um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen.
Wer Biodiversität schützt, schützt Leben. Unser Leben.